Leipziger Schutzeinrichtungen am Limit
Gibt es ausreichend Hilfe für Betroffene häuslicher Gewalt? Diese Frage stellt Redakteurin Margarete Arendt in unserer aktuellen Printausgabe.
In Deutschland fehlten 2023 etwa 13.000 Plätze in Frauen*häusern, wodurch davon ausgegangen werden muss, dass eine große Menge Betroffener abgewiesen wird. Abweisungen werden allerdings nicht konsequent statistisch dokumentiert. Zu diesen Ergebnissen kommt der Verein Frauenhauskoordinierung, der bundesweit Frauen*häuser und Beratungsstellen unterstützt, in seiner Frauen*haus-Statistik für das Jahr 2023. Von einer Verbesserung der Lage seit Erhebung dieser Daten ist nicht auszugehen, da Gewalt gegen Frauen* – laut Lagebild „Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten“ der Bundesregierung von November 2024 – in allen Bereichen zugenommen hat. (Das Sternchen hinter dem Wort „Frau“ ist der Versuch, auch nichtbinäre und inter Personen als Betroffene anzusprechen, Anm. d. Red.)
Wie viele Frauen*hausplätze es in Deutschland geben müsste, um Gewaltschutz für alle garantieren zu können, lässt sich über den Schlüssel der Istanbul-Konvention berechnen. Diese empfiehlt pro 10.000 Einwohnende einen Familienplatz bereitzustellen. Die Istanbul-Konvention ist ein Abkommen des Europarats zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen*.
Wie sieht die Situation in Leipzig aus? Hier gibt es die ständige Sofortaufnahme, die rund um die Uhr eine Anlaufstelle für Betroffene sein soll. Außerdem befinden sich in Leipzig vier Frauen*häuser und zwei Männerschutzwohnungen.
Laut Stefan Adams vom Sozialamt der Stadt Leipzig verteilen sich auf diese Einrichtungen insgesamt 124 Betten, von denen 60 Familienplätze für Erwachsene mit Kind(ern) sind. Damit entspräche die Anzahl der Plätze in etwa der Vorgabe der Istanbul-Konvention. „Allerdings stellen wir fest, dass, obwohl wir die Plätze in den letzten Jahren stark aufgestockt haben, das Angebot immer noch nicht ausreichend ist“, fügt Adams hinzu. Es käme häufig vor, dass die Frauen*häuser bis auf das letzte Bett belegt seien. In diesen Fällen werde versucht, für Betroffene einen Platz außerhalb von Leipzig zu finden. Allerdings würden auch viele Betroffene aus den kleineren Städten und Landkreisen im Umfeld von Leipzig hier Schutz suchen. Wie voll die Frauen*häuser in Leipzig sind, bestätigt auch die mitarbeitende Person Robin (Name von der Redaktion geändert) des ersten Autonomen Frauen*haus Leipzig.
„Je nach Gefährdungslage beginnt man bei einer Person komplett neu“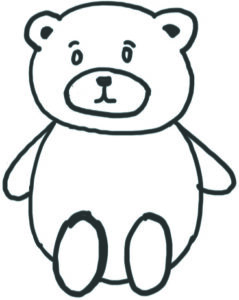
Das erste Autonome Frauen*haus ist eines von zwei Einrichtungen des Vereins Frauen für Frauen. Zum Verein gehört auch noch die KIS (Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking), eine Beratungsstelle für alle gewaltbetroffenen Menschen und das Schutzhaus S.H.E. (Shelter. Help. Empowerment.) speziell für geflüchtete Frauen*. „Der Andrang ist enorm hoch. Dass man sofort einen Platz für eine Person findet, ist wirklich ein Glücksfall“, erzählt Robin. Die Gründe sieht Robin zum einen in der großen Anzahl von Betroffenen, zum anderen im Leipziger Wohnungsmarkt. „Häufig finden Frauen* nicht so leicht Wohnungen und müssen deswegen sehr lange bleiben. Das hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Es gibt viel mehr Anfragen als früher und man findet viel schlechter Wohnungen.“ Robin erklärt, was für eine Person mit Kind(ern) bei der Wohnungssuche noch erschwerend hinzukommt: „Je nach Gefährdungslage beginnt man bei einer Person komplett neu. Für die Kinder sucht man neue Kindergärten oder Schulen und hilft dabei, die ganze Existenz neu zu ordnen und aufzubauen. Und dann ist es natürlich ein Anliegen, eine Wohnung zu finden, die so gelegen ist, dass die Kinder in der Schule und in dem Kindergarten bleiben können, in dem sie sich gerade eingewöhnt haben. Das ist auch für die Gewaltaufarbeitung bei Kindern total wichtig.“
Auch Flo (Name von der Redaktion geändert) führt den Leipziger Wohnungsmarkt als großes Problem im Gewaltschutz an. Flo arbeitet für den Verein lemann, der Träger der Männerschutzwohnungen in Leipzig ist. Laut Flo können in der größeren Männerschutzwohnung bis zu drei Männer und ihre Kinder Schutz finden. Außerdem gäbe es seit 2024 auch noch eine weitere Schutzwohnung, in der ein Vater mit Kind(ern) Platz finden würde. Nicht immer seien alle Plätze belegt, oft genug müssten aber auch Männer abgewiesen werden. Bezahlbarer und verfügbarer Wohnraum hat laut Flo im Gewaltschutz eine Schlüsselfunktion: „Darum geht es ja. Wir stellen in erster Linie Wohnraum, weil der alte Wohnraum nicht mehr sicher ist. Und darum geht es auch bei der Frage, wie es danach weiter geht.“ Flo schlägt eine zentrale Stelle vor, die über einen Pool aus Wohnungen für Gewaltbetroffene verfügt, die schnell und barrierearm vergeben werden könnten.
 Belastende Gerichtsverfahren für Betroffene
Belastende Gerichtsverfahren für Betroffene
Bei der Alltagsgestaltung in der Männerschutzwohnung würde die selbstbestimmte Organisation der Betroffenen unterstützt werden. Flo erklärt, dass in der Männerschutzwohnung nicht permanent Betreuungspersonal anwesend sei: „Die Idee der Wohnung ist, dass diese Personen sich größtenteils selbst organisieren und wir bei Bedarf begleiten. Wenn es zum Beispiel Konflikte gibt, dann moderieren wir das oder wir etablieren den Putzplan. Aber ob die Männer im Alltag miteinander reden oder kochen oder was auch immer – das ist ihnen freigestellt.“ Ansonsten würden die Betroffenen bedürfnisorientiert unterstützt werden. Sei es bei der Arbeitssuche, durch Beratung oder durch Hilfe bei der Suche eines Therapieplatzes.
In den Frauen*häusern gestaltet sich die Betreuung anders, hier ist üblicherweise immer Personal anwesend. Es werden aber auch viel mehr Plätze auf einmal geboten. Das erste Autonome Frauenhaus kann insgesamt 15 Menschen mit Kind(ern) einen Platz zur Verfügung stellen. Auch hier unterstützen Sozialpädagog*innen die Betroffenen bei der Entwicklung einer neuen Perspektive, was oft genug ein Umzug in eine völlig neue Stadt bedeuten würde. „Das ist oft so bei Frauen*, die aus anderen Städten kommen und aufgrund der Gefährdung die Stadt wechseln mussten. Dann sind sie bei uns gelandet und entweder sie wurden vom Täter hier gefunden, oder es wurde über das Gerichtsverfahren die Adresse bekannt gegeben. Dann sind die Frauen* gezwungen, nachdem alles abgeschlossen ist, nochmal den Ort zu wechseln“, berichtet Robin.
Die Gerichtsverfahren seien häufig sehr problematisch, gerade wenn es gemeinsame Kinder gäbe. Zwar würde mittlerweile häufiger das Sorgerecht auf die Mütter übertragen, trotzdem müsse oft noch ein Umgang mit dem gewalttätigen Vater gewährleistet werden. Dadurch wäre kein konsequenter Gewaltschutz möglich. Das Personal im Frauen*haus würde die Frauen* auf die Prozesse vorbereiten und auch oft mit in das Gericht kommen. Außerdem gebe es eine enge und gute Zusammenarbeit mit Anwält*innen, die die Betroffenen vor Gericht vertreten. „Wenn die Gerichtstermine anstehen, ist das psychisch sehr schwer auszuhalten für viele Frauen. Da ist eine enorme Angst, ihre Kinder zu verlieren. Oft sind Täterstrategien zu sagen: Wenn du dich trennst, dann nehme ich dir die Kinder weg. Auch für die Kinder sind diese Gerichtsverfahren enorm belastend, weil sie ja ab einem gewissen Alter selbst aussagen müssen und das in den meisten Fällen für die Kinder der absolute Horror ist.“
Schutz für alle möglich machen
Für die Zukunft wünscht sich Robin, dass die Istanbul-Konvention flächendeckend umgesetzt wird und ein Gewalthilfegesetz verabschiedet wird, dass konsequenten Gewaltschutz ermöglicht: „Ich würde mir wünschen, dass das komplette Gewaltschutzsystem in Deutschland so ausfinanziert und aufgestellt ist, dass jede Frau, die mit ihren Kindern Schutz sucht, zu jedem Zeitpunkt auch Schutz bekommt.“ Flo von lemann würde gerne eine richtige Beratungsstelle für Männer einrichten, denn dafür gäbe es im Moment kein Geld. „Wenn man statistisch argumentiert, sind es 20 bis 30 Prozent männliche Betroffene und ich glaube, wenn mehr Angebote geschaffen werden würden und für das Thema sensibilisiert werden würde, dann würden sich auch mehr Betroffene Hilfe holen.“ Was für Flo aber erstmal zählt, ist der Erhalt der momentanen Strukturen, die stark vom sächsischen Haushalt und der Landesregierung abhängig sind.
Die Leipziger Schutzeinrichtungen und Beratungsstellen für Betroffene von häuslicher Gewalt sind laut Adams aus dem Sozialamt der Stadt Leipzig größtenteils durch den Freistaat Sachsen finanziert, teilweise auch durch die Stadt Leipzig. Damit sind Gewaltschutz und die Umsetzung der Istanbul-Konvention auch eine Entscheidung der Wähler*innen.
Hier bekommst du Hilfe bei häuslicher Gewalt:
Für Flinta*: Zentrale Sofortaufnahme der Frauen*- und Kinderschutzeinrichtung Leipzig | +49 341 550 104 20
Für Männer: lemann e.V. – Männerhaus Leipzig | +49 176 429 028 88
Fotos: Margarete Arendt


Hochschuljournalismus wie dieser ist teuer. Dementsprechend schwierig ist es, eine unabhängige, ehrenamtlich betriebene Zeitung am Leben zu halten. Wir brauchen also eure Unterstützung: Schon für den Preis eines veganen Gerichts in der Mensa könnt ihr unabhängigen, jungen Journalismus für Studierende, Hochschulangehörige und alle anderen Leipziger*innen auf Steady unterstützen. Wir freuen uns über jeden Euro, der dazu beiträgt, luhze erscheinen zu lassen.




